Wortgefechte im Stadtrat und Weichenstellungen für die Zukunft
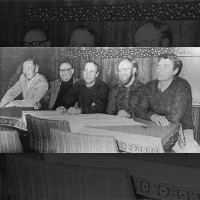
Die Lichtenfelser SPD in den 1980er-Jahren
In den 80er-Jahren kommt es mit dem Auftreten der Grünen zu einer Verschiebung innerhalb der Parteienlandschaft. Doch nicht nur personell oder im Rahmen einer zusätzlichen Fraktion in Landtagen oder im Bundestag hinterlassen die Grünen Eindruck. Auch auf kommunaler Ebene treten die originären Themen der Grünen stärker in den Vordergrund. Bei der Diskussion um die Erweiterung eines Steinbruchs spielen bei der SPD nun auch ökologische Fragestellungen eine Rolle. Verkehrskonzepte und Wegeführungen sollen den Bürger durch Lärm oder Schmutz nicht mehr belasten als zuvor. Auch bei dem Widerstand gegen die Erweiterung des Lichtenfelser Flugplatzes unterstützte der Ortsverein die Bürgerinitiative und teilte ausdrücklich auch die ökologischen Bedenken. Und nicht zuletzt wurde die Rolle der Frau in der Gesellschaft und in der Politik von der SPD aktiv angegangen. Bereits damals wurden Quoten vereinbart, die auch auf lokaler Ebene mehr Frauen in die Politik bringen sollte. Ein hehres Ziel, das bis heute in Lichtenfels und dem männerdominierten Stadtrat unerfüllt scheint.
Insofern kann man in den Presseberichten über Ortsvereins- und Fraktionssitzungen in den 1980er-Jahren durchaus herauslesen, dass sich die Themenvielfalt, mit der sich die SPD-Mitglieder beschäftigten, erweiterte. Mit der Annäherung von Ost und West im Rahmen von Glasnost und Perestroika tat sich gegen Ende der 1980er-Jahre eine ganz neue Herausforderung auf: Die SPD in der DDR musste für die ersten freien Wahlen fit gemacht werden. Hierfür wurden die Ortsvereine Lichtenfels und Schney und auch das Schneyer Schloss zu wichtigen Partnern und Veranstaltungsorten.
Wechsel des Dritten Bürgermeister Heiner Morgenroth in die Stadtverwaltung – Verlust und Chance
Heiner Morgenroth wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 11. Oktober 1989 zum Hochamtsbauleiter und damit zum Nachfolger des aus gesundheitlichen Gründen ausscheidenden Friedrich Nielsen. Mit dem Wechsel in die Stadtverwaltung zum 1. Januar 1990 musste Morgenroth sein Stadtratsmandat aufgeben und auch seinen Posten als Dritter Bürgermeister niederlegen. Heiner Morgenroth, Jahrgang 1936, war zuvor im Bauamt des Landratsamtes tätig und gehörte 18 Jahre lang der SPD-Stadtratsfraktion an. Ein wahrer Experte für kommunale Probleme wurde Morgenroth durch seine Tätigkeit im Bau- und Umweltausschuss, im Bauherrenausschuss und im Umlegungsausschuss. Städtische Baumaßnahmen waren ihm also detailliert bekannt.
Für die SPD-Stadtratsfraktion und den Ortsverein war der Wechsel von Morgenroth ein harter Schlag. „Als Mann des Ausgleichs war Morgenroth überaus beliebt, was sich auch in den Kommunalwahlergebnissen niedergeschlagen hatte.“ Der Ortsvereinsvorsitzende Winfred Bogdahn kommentierte in der Ausgabe des Fränkischen Tages den Verlust von Morgenroth als Zugpferd im Kommunalwahlkampf wie folgt: „Wir verlieren damit sicherlich einen populären Kommunalpolitiker in unserer Fraktion.“
Morgenroths Wechsel machte aber auch die Bahn frei für zwei entscheidende Personalien, die den Kurs der Lichtenfelser SPD in den folgenden Jahrzehnten maßgeblich prägen werden. Monika Faber rückte in den Stadtrat von Lichtenfels nach und ist zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen noch immer und ununterbrochen Mitglied des Stadtrats. Winfred Bogdahn wurde durch den Weggang Morgenroths zum Listenführer der SPD bei den Stadtratswahlen 1990. Er konnte nach einer Übergangsphase, in der Erich Strähnz, Urgestein der Schneyer SPD und letzter Schneyer Bürgermeister, Dritter Bürgermeister wurde, das Amt von 1991 bis zu seiner Wahl zum Ersten Bürgermeister 1992 ausüben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Bogdahn in einem Interview 1990 angibt, dass bei einer Bewerbung für den Posten des Dritten Bürgermeisters von ihm oder Peter Dietz nicht mit den Stimmen der CSUler gerechnet werden könnte. „Dies sei ein Novum“, so Bogdahn, „denn bisher habe man sich über die Vergabe der Bürgermeisterämter an die Fraktionen geeinigt, die personelle Ausstattung dieser Ämter aber den jeweiligen Fraktionen zugestanden.“ Man darf durchaus vermuten, dass die teilweise explosiven Diskussionen zwischen den meinungsstarken und konfliktfreudigen SPDlern Dietz und Bogdahn und der CSU-Fraktion Spuren hinterlassen haben.
Einsatz für Bürgerversammlungen und Bürgergespräche
Mit dem Ende der 1980er-Jahre setzt der SPD-Ortsverein einen politischen Schwerpunkt bei der Einführung von regelmäßigen Bürgerversammlungen in den einzelnen Stadtteilen. „Alle Bemühungen der SPD in diese Richtung seien bisher gescheitert, vor allem am Widerstand des Bürgermeisters und der CSU-Fraktion.“ Strähnz und Dietz warfen dem damaligen Bürgermeister Dr. Hauptmann vor, in Wahlzeiten auch in jeden Ort zu kommen. Dabei fuhr Peter Dietz schwere Geschütze auf: Eine Gehaltshöherstufung des Bürgermeisters im Jahr 1979 wurde auch damit begründet, dass auf Grund der zahlreichen Ortsteile ein höherer Arbeitsaufwand betrieben werden müsse. „Nun muss der Bürgermeister sich auch den Bürgern stellen“, so Dietz.
Wende 1989 und Starthilfe für die SPD in der DDR
Im Juli 1990 kamen der Bürgermeister der Stadt Kahla und andere ostdeutsche Kommunalpolitiker auf Einladung der SPD-Stadtratsfraktion zu einem Arbeitsbesuch. Dabei ging es darum, die Gäste mit Knowhow zu den Themen Wasser, Gas und Abwasser zu versorgen, damit sie „angesichts des Riesenbergs zu lösender Aufgaben“ und dem Mangel an Geld trotzdem handlungsfähig werden. Dritter Bürgermeister Bogdahn und der Fraktionsvorsitzende Dietz hatten außerdem CSU-Bürgermeister Hauptmann eingeladen, der im Rahmen eines Arbeitsfrühstücks auch anwesend war. Eine Geste der Überparteilichkeit, die von Hauptmann angenommen wurde. Solche und weitere Austausche zwischen den Kommunalpolitikern fanden in den Jahren 1989 und 1990 häufiger statt. So beispielsweise im Februar 1990, als der SPD-Unterbezirk Kulmbach/Lichtenfels die Sozialdemokraten aus Saalfeld traf, und beide eine enge Zusammenarbeit beschlossen.
Ganz praktische Hilfe leistete der Ortsverein im Februar 1990, als dem anwesenden Wahlkampfleiter aus dem Bezirk Aue 2 000 Blatt Papier übergeben wurden. Weitere Maßnahmen wurden in den folgenden Wochen umgesetzt. Mit diesen Aktionen wollte der SPD-Ortsverein dafür sorgen, dass Lichtenfels zu einer „Drehscheibe der Ost-West-Kontakte werde und keine Durchgangsstation.“
Stadtratswahl 1990
Die Themen der Kommunalwahl 1990 waren sehr vielseitig. Neben der „Schadensbegrenzung“ bei den Projekten Billinger-Trasse und Mehrzweckhalle setzte der Ortsverein auf die Einführung von Bürgerversammlungen in den Ortsteilen, die Renovierung und den Bau von Kinderspielplätzen und die Renovierung der Jugendherberge. Auch die Innenstadtsanierung, ein rascher Ausbau des Kastenbodens und eine kommunale Wohnungsbauförderung wurden von Listenführer Winfred Bogdahn und dem ausscheidenden Fraktionsvorsitzenden Erich Strähnz aus Schney als wichtige Aufgaben benannt.
Bauprojekte der 80er-Jahre: Billinger-Trasse, Stadthalle, Stadtschloss und Jugendzentrum
Stadthalle:
Bau der Stadthalle war ursprünglich mit drei Millionen Euro kalkuliert. Endkosten waren dann aber acht Millionen Euro. Die Kostensteigerung entstand hauptsächlich dadurch, dass kontinuierliche Nachrüstungen vorgenommen werden mussten. So wurde nachträglich beispielsweise eine Halle für Requisiten und Bestuhlung errichtet. Bereits im Rahmen der Planungen im Jahr 1985 schlugen die Wellen im Stadtrat hoch. Unnötig sei die Stadthalle und eine Konkurrenz zu Stadtschloss und Bergschloss; denen würde durch die neue Mehrzweckhalle „das Wasser abgegraben.“
Billinger-Trasse:
Im Jahr 1984 wurde das Billinger-Konzept / Billinger-Trasse vorgestellt. Darin wurde versucht, die Verkehrsdrehscheibe vom Marktplatz wegzubringen und in den Bereich des ehemaligen Bürgerbräu-Geländes zu verlagern. Eine Brücke über die Bahnlinie (heute F.-J.-Strauß-Brücke) sollte für die Entlastung der Innenstadt sorgen. Die Billinger-Trasse sollte in den kommenden Jahren zu einem steten Zankapfel im Lichtenfelser Stadtrat werden. Die SPD-Fraktion und auch der Ortsverein stellten sich von Beginn an der Billinger-Trasse gegenüber als skeptisch dar. Neben der Notwendigkeit wurde vor allem in Frage gestellt, ob die Einbindung der Anwohner und Bürgerinnen und Bürger ausreichend gewesen wäre. Leserbriefe aus den Monaten Juni und Juli, die sowohl von Mitgliedern einer Bürgerinitiative gegen die Billinger-Trasse als auch von Stadträten waren, zeichnen hier ein eindeutiges Bild.
Die Ablehnung des Haushalts 1985 der Stadt Lichtenfels durch die SPD-Stadtratsfraktion wurde durch den Stadtrat Bogdahn damit begründet, dass die Fraktion das Verkehrskonzept des Planungsbüros Billinger grundsätzlich ablehnt. Gelder für die Weiterführung und Umsetzung der Planungen können laut Bogdahn nicht guten Gewissens freigegeben werden. Wenn auch der Haushalt „in der größten Zahl der Einzelposten akzeptabel ist.“
Die Ablehnung des Haushaltes durch die SPD-Stadtratsfraktion führte zu einem starken Bruch zwischen den Kommunalpolitikern der unterschiedlichen Lager. Dr. Hauptmann äußerte „Zweifel am Demokratieverständnis“ der SPDler, die im Stadtrat immer nur Nein sagen würden und forderte „vom Oppositionsdenken“ loszukommen. Die SPD unterstellte dem Bürgermeister und der CSU-Fraktion, ihre Mehrheit „radikal“ auszunutzen. Dabei würden Steuergelder verschwendet und „missliebige Dinge“ würden „einfach niedergestimmt“.
Der Streit rund um die Billinger-Trasse sollte das Klima im Stadtrat noch über Jahre hinaus vergiften und für verhärtete Fronten sorgen. Das Obermain Tagblatt schrieb in Bezug auf die beiden großen Stadtratsfraktionen von erbitterten „Kampfhähnen“. Die CSU-Mehrheit im Stadtrat zeigte aber auch ein ums andere Mal, dass unliebsame Diskussionen nicht geführt werden möchten. So wurde beispielsweise der Sachstandsbericht, der zu Beginn jeder Sitzung gehalten werden musste, kurzerhand von der Tagesordnung genommen. Ein Antrag der SPD, das Thema dennoch zu besprechen, wurde mit einer Aufhebung des Beschlusses durch die Mehrheit der CSU gekontert. Begründung: Ausufernde Diskussionen. Daraufhin vermutete Stadtrat Bogdahn, dass die CSU die „Transparenz fürchte“, woraufhin der Fraktionsvorsitzende der CSU, Walter Benecke, Bogdahn als „Großinquisitor“ bezeichnete. Das Obermain Tagblatt hatte mit seiner Zwischenüberschrift sicherlich recht: „Im Stadtrat flogen die Funken.“ Und auch die CSU-Fraktion konstatierte, dass es im Stadtrat zu diesem Zeitpunkt „zahlreiche Differenzen“ gebe. Diese seien aber auf die bevorstehende Bürgermeisterwahl zurückzuführen.
Im Juni 1986 schließlich stellte der Stadtrat mit der Mehrheit der CSU und zehn Gegenstimmen fest, dass die Billinger-Trasse zum vorrangigsten Ziel der Stadtplanung erklärt werden würde. Ziel der Trasse war eine Entlastung der Innenstadt, indem neue Strecken über die Bahnlinie (heute Dr.-Hauptmann-Ring) gefunden werden, die dann Bamberger und Kronacher Straße mit der Mainau verbinden sollten. Gegen die Ursprüngliche Planung richteten sich 8 000 Unterschriften einer Bürgerinitiative, und der geballte Widerstand der SPD-Fraktion.
Stadtschloss:
Heinrich Morgenroth gab in einer Sitzung der SPD-Stadtratsfraktion im März 1988 Bericht über die Baufortschritte am Kastenboden ab. Dabei konstatierte er, dass langsam aber sicher Fortschritte gemacht werden würden. Allerdings würde „keiner so genau wissen, wofür der Kastenboden eigentlich genau genutzt werden soll“. Die SPD habe im Vorfeld der Renovierung gefordert, eine genaue Analyse der künftigen Nutzungsmöglichkeiten vorzunehmen, so Stadtrat Martin Tempel. Die SPD stand damals der Renovierung durchaus positiv gegenüber, allerdings wurden Sorgen bezüglich der Kosten laut. Dass das Stadtschloss nach der Renovierung mehrere Jahre zwischen unterschiedlichen Nutzungskonzepten hin und her pendelte, war wohl auch Resultat einer im Vorfeld nicht ausreichend durchgeführten Nutzungsanalyse. Heute ist das Stadtschloss aus dem kulturellen Leben der Stadt Lichtenfels nicht mehr wegzudenken und auch als Veranstaltungsort für Hochzeiten recht beliebt. Die gastronomischen Einbauten, die damals viel Geld kosteten, werden allerdings seit vielen Jahren nicht mehr genutzt. Mehr überparteiliche Zusammenarbeit hätte hier Fehlentwicklungen vielleicht vorbeugen können.
Jugendzentrum:
Im Hinblick auf die erstarkenden Neonazi-Strukturen im Landkreis Lichtenfels wurde in einer Ortsvereinssitzung im Frühjahr 1988 darüber diskutiert, ob an einer Podiumsdiskussion mit der NPD teilgenommen werden sollte. Die Meinungen gingen hier auseinander. Auf der einen Seite sollte man Rechtsradikalen keine Bühne bieten, andererseits müsse man die Diskussion nicht fürchten: „Man hat ja die besseren Argumente.“ Und eine „Vogel-Strauß-Politik“ wie sie die CSU betreibe – sei völlig abzulehnen. Stadtrat Peter Dietz meinte, „Angst vor Gewalt dürfe nie die politische Diskussion behindern, denn gerade dies sei der Beginn, dass Gewalt die Politik beherrsche“. Der Bericht sagt viel über den Zustand der öffentlichen Meinung aus. Das Erstarken der NPD und der Republikaner in den 1980er-Jahren stellte die Republik und alle politisch engagierten Menschen vor eine echte Herausforderung: Wie umgehen mit Populisten, die viel versprechen und Angst schüren. In Hinblick auf die heute geführte Diskussion rund um die AfD ergeben sich erschreckend viele Parallelen. Da sich NPD und Republikaner als recht kurzlebiges Phänomen herausstellten, mussten die Parteien und Politiker sich ihrer Beteiligung am Aufstieg rechten Gedankengutes nicht stellen. Vielleicht wären die Lerneffekte aus diesen Jahren heute wichtiges Grundwissen der Politiker und Parteien und hätten den Aufstieg der AfD verhindern oder zumindest abmildern können.
Damals wurde in der Ortsvereinssitzung darauf hingewiesen, dass Jugendliche „von der Straße“ geholt werden müssten, damit sie nicht zu leichten Opfern für „halbmilitärische Organisationen mit Führerprinzip“ werden. Als wichtiges Mittel wird dabei das Jugendzentrum genannt. Ein Herzensprojekt der Lichtenfelser Sozialdemokraten, das bislang am „kategorischen Nein der CSU-Mehrheit gescheitert ist“. Es sollte sich erst in den 90er-Jahren unter dem SPD-Bürgermeister Winfred Bogdahn realisieren lassen.
Doch bereits 1985 hat Monika Faber die Forderung nach einem Jugendtreff formuliert. Dabei gehe es vor allem darum, den Jugendlichen, die nicht in Vereinen oder Kirchen engagiert sind, „ein Angebot sinnvoller Freizeitbeschäftigung zu bieten“.
- Autor: Philip Bogdahn -
